Rhodium ist ein seltenes Metall, das nicht rostet.

Home » Sicherheit » Materialien » Rhodium
Rhodium ist ein seltenes Metall, das nicht rostet.

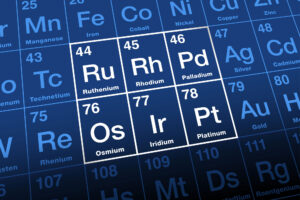
Rhodium (chemisches Elementsymbol Rh) ist ein seltenes, silberweiß glänzendes und korrosionsbeständiges Übergangsmetall. Es gehört zu den Platingruppenelementen (Ruthenium, Rhodium, Palladium, Osmium, Iridium und Platin). Rhodium wurde 1803 vom britischen Chemiker William Hyde Wollaston entdeckt, als dieser versuchte, Platin für den Verkauf zu isolieren. Der Name stammt vom griechischen Wort „rhodon“ (Rose), weil bei der Entdeckung rosa Kristalle entstanden.
Rhodium zählt zu den härtesten und seltensten Elementen auf der Erde. Es ist langlebig, verfügt über ein hohes Reflexionsvermögen und zeigt eine hohe katalytische Aktivität. Diese Eigenschaften machen es zu einem begehrten Metall. Seine Verwendung beschränkt sich nicht nur auf den Einsatz als Legierung in Katalysatoren, sondern findet auch in vielfältigen Technologien Anwendung .
Die Automobilindustrie setzt Rhodium in Drei-Wege-Katalysatoren ein. Darin wandelt es schädliche Stickoxide in weniger schädliche Stoffe Stickstoff (N₂) und Kohlendioxid (CO₂) um. Neben Rhodium enthalten Drei-Wege-Katalysatoren oft auch Platin und Palladium. Diese sind für die Umwandlung von Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid (CO) zu Wasser und Kohlendioxid (CO2) verantwortlich . Die chemische Industrie nutzt Rhodiumkatalysatoren zur Herstellung bestimmter Grundchemikalien. Ein Beispiel ist das Ostwald-Verfahren zur Herstellung von Salpetersäure.
Rhodium ist außerdem sehr beliebt in der Schmuckindustrie. Es ist extrem widerstandsfähig gegenüber Korrosion und Oxidation, selbst bei hohen Temperaturen. Deswegen verwendet man es zur Veredelung von Schmuckstücken wie Weißgold oder Silber. Dieser Prozess heißt „Rhodinieren“. Er sorgt für eine helle, glänzende und abriebfeste Oberfläche, die den Schmuck länger schön erhält. Rhodium ist in Schmuckstücken sehr hautverträglich (z. B. bei nickelfreiem Schmuck).
Darüber hinaus nutzt man es in der Elektronikbranche zur Beschichtung von elektrischen Kontakten, um Korrosion zu verhindern und die Leitfähigkeit zu verbessern. Außerdem verwenden Forschende dünne Rhodium-Schichten für hochreflektierende Spiegel in Geräten, z. B. zur Röntgen-Bildgebung.
Interessanterweise kommt Rhodium auch in Detektoren in Kernreaktoren zum Einsatz, um die lokale Leistung oder den Neutronenfluss in einem bestimmten Bereich des Reaktors zu messen.
Das Metall spielt zudem eine noch eher spezialisierte, aber interessante Rolle in der Wasserstoffwirtschaft. In manchen Elektrolyseverfahren (z. B. PEM-Elektrolyse) wird Rhodium als Beschichtung oder Legierungskomponente verwendet, um die Wasserstoffentwicklung (HER – Hydrogen Evolution Reaction) effizienter zu gestalten. In Brennstoffzellen dient es als Legierung für Elektrodenmaterialien. Rhodium reduziert die Vergiftung des Katalysators durch Kohlenmonoxid und erhöht somit dessen Lebensdauer . Aufgrund des hohen Preises und der begrenzten Verfügbarkeit bleibt Rhodium jedoch eine maßgeschneiderte Lösung für besonders anspruchsvolle Anwendungen.
Rhodium hat keine bekannte Funktion im menschlichen Körper. In bestimmten Formen kann es gesundheitsschädlich sein.

Die Gewinnung von Rhodium ist sehr aufwendig. Das liegt vor allem daran, dass die Platingruppenelemente ziemlich ähnlich sind und nicht so leicht chemisch reagieren . Das macht ihre Trennung schwierig und sehr teuer.
Aus diesem Grund gewinnt das Recycling von Rhodium immer mehr an Bedeutung. Der größte Teil des Rhodiums lässt sich aus alten Autokatalysatoren, Elektroschrott und Schmuck zurückgewinnen. Die größten Produzenten sind Südafrika, Russland und Simbabwe, was zu geopolitischen Risiken führt .
Im März 2024 wurden die Platingruppenelemente als 27. kritisches Material auf der Liste der 34 strategischen Rohstoffe (SRM) gemäß dem Europäischen Gesetz zu kritischen Rohstoffen aufgeführt.
Weiterführende Informationen:

Rhodium ist ein seltenes Edelmetall aus der Gruppe der Platinmetalle. Es wird zum Großteil gemeinsam mit Platin als Nebenprodukt im Nickel-, Eisen- und Kupferabbau gewonnen. Deshalb lassen sich viele Nachhaltigkeitsindikatoren für Rhodium nur schwer oder gar nicht bestimmen. Die Republik Südafrika, die Russische Föderation, Kanada und Simbabwe sind weltweit die wichtigsten Förderländer für Rhodium (2022). Die Rhodiumförderung betrug 2019 weltweit 25 t, wovon allein auf Südafrika 20 t entfielen. Der Abbau erfolgt größtenteils untertage, einige Förderstätten arbeiten auch im Tagebau.
Ähnlich dem Ruthenium ist auch Rhodium ein Nebenprodukt der Kernspaltung und kann aus abgebrannten Brennelementen gewonnen werden. Aufgrund der Radioaktivität der anderen Materialien in den Brennelementen und den damit verbundenen Sicherheitsauflagen wird Rhodium jedoch nicht auf diese Weise gewonnen.
Die Landnutzung für die Förderung von Rhodium ist vergleichbar mit der im Kupferbergbau. Der Untertageabbau verbraucht dabei weniger Fläche, da weniger Abraum gelagert werden muss. Bei der Förderung besteht ein hoher Wasserverbrauch pro Tonne gefördertem Erz. Der Energie- und Wasserverbrauch für die Weiterverarbeitung der Erze ist hoch
Rhodium ist, ähnlich wie Ruthenium, in metallischer Form ungiftig. Als Pulver ist es leicht brennbar. Rhodiumverbindungen wiederum können ätzend für Augen, Haut und Lunge sein und es existieren verschiedene Richtlinien für die Arbeit und den Umgang mit Rhodium.
Rhodium kann toxisch für Wasserorganismen sein . Allerdings ist seine Toxizität geringer als jene von Platin und Palladium. Da es nur in sehr geringen Mengen in der Umwelt vorkommt, sind keine Auswirkungen auf Umweltorganismen zu erwarten.
Es gibt Hinweise auf eine krebserregende Wirkung von Rhodium und seinen Verbindungen.
Rhodium wird als Nebenprodukt beim Abbau anderer Materialien gewonnen. Die Erz-Lagerstätten in Russland und Kanada weisen sehr hohe Sulfidgehalte auf. Direkte Emissionen von Schwefeldioxid sind kritisch zu bewerten, bei der Verhüttung werden entsprechend Abgasreinigungssysteme eingesetzt. In den Absetzbecken (Tailings) kann ein hoher Schwefelgehalt zur Versäuerung führen, weshalb Maßnahmen zur Reduktion der Schwefelgehalte im Abraum etabliert wurden.
Ebenso als kritisch zu bewerten sind indirekte Emissionen, die bei der Weiterverarbeitung der Erze entstehen, hauptsächlich Kohlendioxid aber auch Stickstoffoxid. Die bei der Verhüttung von Rhodium-haltigen Erzen in Südafrika (auch in Simbabwe) eingesetzte elektrische Energie stammt zu einem Großteil aus der Kohleverstromung und ist daher mit hohen CO2-Emissionen verbunden. Das Waschen des Erzes kann schwermetallhaltige Schlämme erzeugen, die in einigen Abbauregionen Flüsse und Grundwasser kontaminieren.
Dem gegenüber steht der Einsatz von Rhodium insbesondere in Abgaskatalysatoren in Fahrzeugen. Hier spielt das Material eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von Stickoxiden in Stickstoff.
Die unternehmerische Konzentration der Bergwerksförderung von Rhodium wird als hoch eingestuft. Das bedeutet, dass von den Gewinnen der Förderung nur wenige profitieren.
Laut dem gewichteten Länderrisiko für die Herkunftsländer von Rhodium, in welches die Indikatoren der Weltbank eingehen (Worldwide Governance Indicators) stammen rund 80 % der Produktion aus Ländern mit mittlerer bis schwacher Governance. Das bedeutet, dass in Punkten wie z.B. politischer Stabilität, Mitspracherecht, Sicherheit und Korruptionsbekämpfung in vielen Förderländern Verbesserungsbedarf besteht.
Für eine verantwortungsvolle Metall-Produktion gewinnt die Sorgfaltspflicht in den Lieferketten in der EU zunehmend an Bedeutung (siehe dazu auch https://de.wikipedia.org/wiki/Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz). Das Gesetz schreibt die Dokumentation oder Zertifizierung von Sozialstandards und Arbeitsschutz vor, zunächst allerdings nur für Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden.
Aufgrund des sehr seltenen Vorkommens von Rhodium, seinen Kosten und der vielseitigen Verwendung als Katalysator und als Komponenten in elektrischen Geräten, ist das Recycling lukrativ und z.B. aus Katalysatoren gut etabliert. Für die Rückgewinnung aus Edelmetallbädern gibt es spezielle Recycling-Pulver.
Darüber hinaus ist Rhodium in abgebrannten Brennelementen enthalten, wird jedoch bisher nicht daraus zurückgewonnen, da das Verfahren aufgrund der Radioaktivität der anderen Elemente sehr aufwändig wäre.
Durch den Einsatz von regenerativen Energien bei der Gewinnung und Verhüttung ließe sich der Treibhausgas-Ausstoß deutlich reduzieren.
Fast 90 % des 2019 zur Verfügung stehenden Rhodiums (35,5 t) wurden in Abgaskatalysatoren verwendet. Aufgrund steigender Anforderungen an die Abgasreinigung wird tendenziell ein steigender Bedarf vorausgesagt, allerdings wird die Zunahme der Elektromobilität zu einer geringeren Nachfrage an Katalysatoren führen.
Durch effizienteren Einsatz in Katalysatoren, eine verbesserte Rückgewinnung aus Abfällen und die Erforschung möglicher Ersatzmaterialien lässt sich der Verbrauch von Rhodium reduzieren. Eine nachhaltigere Nutzung erfordert zudem hohe Recyclingquoten und eine möglichst verlustfreie Kreislaufführung.
Weiterführende Informationen:
Rhodium gehört zu den Platingruppenelementen (PGE) und besitzt vielseitige Eigenschaften. Die wichtigste Quelle zur Freisetzung ist der Autoabgaskatalysator, aus dem eine minimale Menge an Rhodium (neben Platin und/oder Palladium) freigesetzt wird und sich im Feinstaub wiederfindet. Rhodium könnte wie Platin, Palladium oder Ruthenium in Komplexverbindungen als Medikament z.B. gegen Krebs eingesetzt werden.
Im Alltag gibt es zwei Hauptquellen für eine Exposition mit Rhodium (Rh): zum einen rhodinierter Schmuck, der direkt mit der Haut in Kontakt kommt und zum zweiten der Autoabgaskatalysator, aus dem minimale Mengen der katalytischen Platingruppenelemente (PGE) Platin, Palladium und Rhodium freigesetzt werden können. An den Feinstaub der Luft gebunden können diese Elemente dann ebenfalls über die Atmung in die Lunge gelangen. Eine Studie zeigt, dass in deutschen Städten bis zu 1 µg Platin aber nur 0,1 µg Rhodium pro g Staub enthalten sein können .
Obwohl Platin den größten Anteil der PGE im Straßenstaub hat, sind die Mengen an ausgeschiedenem Rhodium (und auch Palladium) in menschlichem Urin höher im Vergleich zu Platin, was auf eine bessere Bioverfügbarkeit von Rhodium (und auch Palladium) hinweist .
In bestimmten spezialisierten Branchen (z.B. in der Produktion von Autoabgaskatalysatoren, der Galvanik oder der Schmuckverarbeitung) können Arbeitnehmende Rhodium ausgesetzt sein, z.B. bei Rhodinierungen von Oberflächen. Weiter gibt es in Speziallaboren, in der Elektronikfertigung (z.B. rhodiumbeschichtete Kontakte) und in der Recyclingbranche mögliche direkte Kontakte zu Rhodium. Die wichtigsten Aufnahmewege sind das Einatmen von Dämpfen, Staub oder Aerosolen sowie der direkte Kontakt mit der Haut.
Die Exposition ist insgesamt eher gering. Sie erfordert dennoch in diesen Arbeitsfeldern geeignete Schutzmaßnahmen, wie einige Fallstudien belegen. Eine Arbeiterin in der Schmuckindustrie entwickelte eine starke Hautentzündung durch Kontakt mit Rhodium. Ein 27-jähriger Arbeiter bekam an einer Anlage zur Oberflächenbeschichtung mit Rhodium leichte Asthmaanfälle und eine Entzündung der Nasenschleimhaut. Dies sind seltene Einzelfälle. Dennoch kann eine Sensibilisierung durch Rhodiumverbindungen nicht ausgeschlossen werden, wie es bei anderen PGE ebenfalls der Fall ist (siehe Platin, Palladium und Ruthenium).
Für Rhodium gibt es weder in Deutschland, Europa noch den USA feste Arbeitsplatzgrenzwerte. Für manche Rhodiumverbindungen gibt es Vorgaben bei einem möglichen Hautkontakt, aber für Rhodium-haltige Stäube ist nur der allgemeine Staubgrenzwert einzuhalten (siehe Granuläre biobeständige Stäube).
Privatpersonen kommen mit Rhodium selten in Kontakt. Rhodium ist in metallischer Form kaum toxisch. Es wird hauptsächlich in Produkten wie Schmuck (vor allem aus Silber- und Weißgold als sog. rhodinierter Schmuck) oder Autoabgaskatalysatoren verwendet. Rhodinierter Schmuck gilt als hypoallergen und unbedenklich. Nur bei wenigen sehr sensiblen Menschen kann Rhodium dennoch allergische Reaktionen hervorrufen.
Umweltbelastungen durch Rhodium (z. B. durch Autoabgaskatalysatoren) sind nachgewiesen, aber minimal und gesundheitlich unbedenklich . Rhodium wird weder in Kosmetika noch in Lebensmitteln verwendet. Insgesamt besteht für Verbrauchende kein relevantes Gesundheitsrisiko durch Rhodium.
Für Verbraucher besteht unter normalen Bedingungen ein sehr geringes Risiko einer Rhodium-Exposition. Rhodinierter Schmuck ist in der Regel unbedenklich. Umweltbelastungen durch Rhodium sind niedrig. Personen mit bekannter Metallallergie sollten jedoch auf mögliche Reaktionen durch Rhodiumsalze achten und gegebenenfalls auf rhodinierten Schmuck verzichten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die „Agency for Toxic Substances and Disease Registry“ (ATSDR) in den USA, die Europäische Chemikalien Agentur (ECHA) und weitere Behörden stufen Rhodium aktuell nicht als relevant für eine breite Verbraucherexposition ein.
Rhodium kann vor allem in seiner ionischen Form (als Rhodiumsalze) sowohl über die Lunge als auch über die Haut aufgenommen werden. Allerdings sind die Mengen sehr gering. Eine relevante Exposition ist nur an speziellen Arbeitsplätzen gegeben.
Die Aufnahme von Rhodium (Rh) über die Lunge wird nahezu ausschließlich durch Autoabgaskatalysatoren verursacht. Eine deutsche Studie zeigte, dass Menschen in Städten mehr Rhodium im Urin hatten als Menschen auf dem Land. Die Unterschiede waren sehr klein. Die aufgenommenen Mengen an Rhodium sind zwar höher als die von Platin (Pt), aber weit unter bedenklichen Werten. Ähnliche Ergebnisse gab es schon früher bei Straßenbahnfahrern in Rom. Diese zeigten leicht erhöhte Werte an Platin und Rhodium im Urin verglichen zu einer Kontrollgruppe. Auch in einer indischen Studie zeigte sich ein Zusammenhang: Bei Verkehrspolizisten in Hyderabad wurden die Blutwerte von Platin, Palladium und Rhodium in Abhängigkeit vom Dienstalter untersucht. Alle drei Elemente waren im Blut der untersuchten Personen erhöht, verglichen zur nicht exponierten Kontrollgruppe. Weitere Studien zeigen, dass künstliche Lungenflüssigkeit in der Lage ist, Rhodium und andere Platingruppenelemente aus Straßenstaub lösen zu können – das erklärt die Belastung im Körper .
Die wenigen Studien, die sich mit der Aufnahme von Rhodium über die Haut beschäftigt haben, haben dafür ein spezielles in vitro System eingesetzt, die sogenannte Franz-Zelle. In diesem System wird echte Haut, (z. B. Schweinehaut oder Hautproben von freiwilligen Probanden), so in ein Gefäß eingespannt, dass „außen“ und „innen“ auch räumlich voneinander getrennt sind. Zwar ist diese experimentelle Anordnung anfällig für Fehler (z. B. durch Undichtigkeiten an den eingespannten Seiten des Hautstückes), jedoch kann sie viele Tierversuche ersetzen.
Bei Exposition der Haut in der Franz-Zelle mit löslichen Platin- oder Rhodiumsalzen wurde deutlich mehr Platin durch die Haut transportiert oder in der Haut abgelagert als Rhodiumsalze. Nach 24 Stunden waren dies aber immer noch sehr kleine Mengen, die durch die Haut gelangt sind. Ganz anders die Ergebnisse, wenn Platin und Rhodium Nanopartikel untersucht wurden. Obwohl diese Partikel sehr klein waren (Durchmesser < 10 nm), konnte kein Transport durch die gesunde Haut nachgewiesen werden. Nur wenn die Haut mit einer Nadel verletzt wurde, konnte ein Durchdringen von Partikeln von „außen“ nach „innen“ in der Franz-Zelle gemessen werden. In einer dritten Studie wurde ein lösliches Rhodiumsalz (Rhodiumtrichlorid, RhCl3) unter verschiedenen pH-Werten auf die Haut gegeben und der Durchtritt durch die Haut analysiert. Diese Studie konnte nachweisen, dass saure Bedingungen (niedriger pH-Wert) zu einer Erhöhung der durch die Haut transportierten Menge an Rhodium führten .
Im täglichen Leben spielen die Platingruppenelemente (PGE) und speziell Rhodium für den Magen-Darm-Trakt kaum eine Rolle, da über die Nahrung oder das Trinkwasser kein Rhodium aufgenommen wird. Dennoch wurde in einer Studie untersucht, ob aus Autoabgaskatalysatoren freigesetzte Platin-, Palladium- oder Rhodium-Teilchen überhaupt bioverfügbar wären, sollten sie in den Magen und den Darm gelangen . Zu diesem Zweck wurde mit künstlicher Magen- und Darmflüssigkeit untersucht, wie viel Platin, Palladium und Rhodium aus Feinstaub gelöst werden kann. Palladium und Rhodium waren besser löslich als Platin. Trotzdem war die verfügbare Menge am höchsten bei Platin, weil es in Katalysatoren am häufigsten vorkommt. Da aber nur sehr wenig über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen wird, spielt dieser Weg für die Gesundheit kaum eine Rolle.
Wie auch die anderen Platingruppenelemente könnte auch Rhodium als mögliches Tumormedikament eine Rolle spielen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler setzen Rhodium in Verbindungen ein, die sich in die DNA von Tumorzellen zwängen (Fachausdruck „Interkalieren“). Als sogenannte „Metalloinsertoren“ hindern diese Verbindungen die Tumorzellen an der Teilung. Eine andere Anwendung ist die Kombination von Rhodiumcitrat mit sogenannten SPIONs, kleinen magnetischen Eisennanopartikeln. Diese lassen sich mit einem Magnetfeld von außen an die Stelle des Tumors dirigieren und liefern so das wirksame Rhodiumcitrat an den Tumorzellen ab . Beide Anwendungen befinden sich im Forschungsstadium und haben noch nicht die klinische Anwendung erreicht .
Eine Rhodiumaufnahme ist vor allem im beruflichen Umfeld zu sehen (Beschäftigte im Verkehr oder in der Industrie). Für die Allgemeinbevölkerung zeigen alle bisherigen Erkenntnisse, dass Rhodium kaum aufgenommen wird und kein gesundheitliches Risiko besteht.
Metallisches Rhodium wirkt kaum schädlich auf den Körper. Große Mengen an Rhodiumsalzen können unter Umständen Effekte im Körper entfalten. Solche Mengen werden aber selbst durch Straßenverkehrsstaub und Abgase nicht erreicht.
In einer wissenschaftlichen Studie haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Ratten für 2 Wochen mit einem Rhodiumsalz (Rhodium-(III)-chlorid) über das Trinkwasser behandelt. Dosierungen von 0,25 mg, 0,5 mg und 1 mg Rhodiumsalz pro Liter führten zu leichten Nierenfunktionsstörungen. Die Effekte wiesen allerdings große Schwankungen auf und wurden bisher nicht nochmals bestätigt .
Eine klinische Studie berichtet über einen 27-jährigen männlichen Patienten, bei dem eine Rhodium Sensibilisierung beobachtet wurde . Der Mann hatte drei Jahre mit Elektrolyt-Bädern zur Plattierung gearbeitet und dabei Kontakt zu Platin-, Gold-, und hauptsächlich Rhodiumsalzen. Demnach kann Rhodium in sehr seltenen Fällen eine sensibilisierende bzw. allergisierende Wirkung beim Menschen haben.
Die Studienlage für eine Bewertung der Toxizität von Rhodium im Menschen ist aber nach wie vor sehr dürftig. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass dieses Metall eine sehr geringe Wirkung entfaltet, wenn es mit biologischen Systemen interagiert. Daher hat die International Agency for Research on Cancer (IARC) auch keine Einstufung für eine mögliche krebserzeugende Wirkung von Rhodium vorgenommen. Allerdings weisen sowohl die niederländische Gesundheitsausschuss im Jahr 2002 als auch die deutsche MAK-Kommission (2025) darauf hin, dass es zu wenige Studien für die Rhodiumsalze gibt, und damit diese Verbindungen nicht sicher genug bewertet werden können. Der niederländische Gesundheitsausschuss forderte daher eine Eingruppierung in die ehemalige EU-Kategorie 3B (möglicherweise krebserregend), was aktuell nach der Neudefinition der Einstufungen im Jahr 2008 in der EU der Kategorie 2 entspricht (EUR-Lex Nr. 1272/2008, Anhang 1, 3.6). Auch die MAK-Kommission hat Rhodium und seine Verbindungen als möglicherweise krebserregend eingestuft, was in der speziellen Regelung in Deutschland der KanzKat 3 entspricht. In allen Fällen ist die Eingruppierung allerdings wegen fehlender Studien und nicht wegen vorhandener Beweise vorgenommen worden. Daher sind diese Eingruppierungen derzeit als Sicherheitsmaßnahme gemäß dem Vorsorgeprinzip zu sehen, und nicht als wissenschaftlich begründete Maßnahme.
Die meisten Daten zu Rhodium stammen aus Experimenten mit Zellkulturen. Vor allem durch Vergleiche zu anderen Platingruppenelementen (PGE) können zu Rhodium einige wichtige Aussagen gemacht werden.
So haben mehrere Studien ergeben, dass Rhodium das Element mit der schwächsten biologischen Wirkung ist (verglichen mit Platin und Palladium). Übereinstimmend war Platin in verschiedenen Zelltests 30-fach und Palladium 3-fach stärker wirksam als Rhodium. Die gleiche Reihenfolge sowie die gleichen Unterschiede in der Toxizität hat eine andere Studie mit menschlichen Lungenzellen bestätigt .
Für Rhodium-Nanopartikel (15 nm) wurde sogar beobachtet, dass sie die Bildung von Sauerstoffradikalen reduzieren, somit die Lipidperoxidation hemmen und menschliche Darmzellen (Caco-2) vor dem schädlichen Einfluss von Wasserstoffperoxid (H2O2) bewahren können, ohne selbst einen toxischen Effekt auszulösen .
Anders dagegen verhält es sich, wenn lösliche Salze untersucht werden. Rhodiumsalze hemmen das Wachstum, die Teilung und Überlebensfähigkeit von verschiedenen Kulturzellen .
Bei Kontakt mit menschlichen frisch isolierten Lymphozyten können die Salze von Platin, Palladium und Rhodium das Wachstum der Zellen als auch die Bildung von Botenstoffen (Cytokinen) negativ beeinflussen . Auch hier ist Rhodium am wenigsten wirksam und benötigt sehr hohe Konzentrationen, um einen Effekt auslösen zu können.
Rhodium ist sehr gering toxisch und hat als metallischer Nanopartikel sogar protektive, also schützende Wirkung. Aus diesem Grund gibt es auch keine spezifischen Grenzwerte für dieses Element.